Lesedauer 6 MinutenAntworten von Pandit Rajmani Tigunait
Frage Agni-Magazin: Was ist das Yoga Sutra und warum ist es so wichtig?
Pandit Rajmani Tigunait sagt dazu: Das Yoga Sutra von Patanjali ist das Herzstück der Yoga-Tradition. Diese ehrwürdige Schrift ist das A und O der Yoga-Philosophie und -Praxis. Der Versuch, Yoga zu praktizieren, ohne das Yoga Sutra zu kennen, ist wie der Versuch, ein Land zu regieren, ohne seine Verfassung zu kennen.
Es ist wichtig, gleich zu Beginn zu verstehen, dass sich das Wort Yoga im Zusammenhang mit dieser Schrift auf die Fähigkeit des Geistes bezieht, sich selbst und seine Beziehung zum Körper zu erkennen, seine Beziehung zur Welt zu erkennen und schließlich die innere und ewige Wirklichkeit zu erkennen, die schon vor unserer Geburt existierte, die uns begleitet, während wir leben, und die auch nach unserem Tod weiterbesteht. Kurz gesagt, das Yoga Sutra ist eine Anleitung, wie wir unsere innere Göttlichkeit erfahren und uns in ihr verankern können.

„Diese ersten drei Sutras – eine Erklärung der Unabhängigkeit von Körper, Geist und Seele – sind das Herzstück des ersten Kapitels.“
Der Text selbst besteht aus 195 Sutras (Aphorismen), die in vier Kapitel oder Padas (Schritte) unterteilt sind. Das erste Kapitel, „Samadhi Pada„, der Schritt zur Erlangung eines ruhigen und reinen Geistes, beschreibt die Voraussetzungen, um unsere wahre Natur zu entdecken und in ihr zu verankern. Dieses Kapitel enthält 51 Sutras. So wie die Unabhängigkeitserklärung den Grundstein für die Freiheit in den Vereinigten Staaten gelegt hat, legen die ersten drei Sutras dieses Textes den Grundstein für die Freiheit, die uns die Yoga-Praxis verleiht. Diese ersten drei Sutras – die Erklärung der Unabhängigkeit von Körper, Geist und Seele – sind das Herzstück des ersten Kapitels, und das erste Kapitel ist das Herzstück der übrigen drei Kapitel.
Das zweite Kapitel, „Sadhana Pada„, der Schritt zum Üben von Yoga, enthält 55 Sutras. Hier wird die große Bandbreite der Yoga-Praktiken in kleinere Schritte unterteilt, damit Menschen mit unterschiedlichen körperlichen, emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten die für sie am besten geeigneten Praktiken auswählen können. Die in diesem Kapitel beschriebenen Übungen haben zwei Ziele: Samadhi – einen vollkommen ruhigen, ursprünglichen Zustand des Geistes – zu erreichen und die Bedrängnisse zu minimieren, die uns beim Üben behindern. In diesem Kapitel legt Patanjali den achtfachen (Ashtanga) Pfad dar, der als Raja Yoga bekannt geworden ist.
Das dritte Kapitel, „Vibhuti Pada„, enthält 55 Sutras. Vibhuti bedeutet „Erweckung der schlummernden Potenziale“. „Vibhuti Pada“ ist der Schritt zur Erweckung der grenzenlosen Potenziale, die normalerweise in uns schlummern. Wir gehen davon aus, dass wir durch das Studium und die Praxis dessen, was in den ersten beiden Kapiteln beschrieben wurde, unseren Körper, unseren Geist und unsere Sinne weitgehend im Griff haben. In diesem Kapitel erfahren wir, wie wir unseren unberührten, ruhigen Geist nach innen wenden und ihn auf verschiedene Objekte fokussieren können, um so den Umfang unseres Bewusstseins zu erweitern.
„Kaivalya Pada„, das vierte und letzte Kapitel des Yoga Sutras, enthält 34 Sutras. Kaivalya bedeutet „endgültige Freiheit“. Die Praktiken, die in diesem letzten Kapitel beschrieben werden, konzentrieren sich darauf, Freiheit von den bindenden Kräften des Geistes zu erlangen. In diesem Kapitel erfahren wir auch, wie wir die in den drei vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Praktiken sicher und produktiv durchführen können. Patanjali stützt sich dabei auf die Prinzipien des Ayurveda und die Wissenschaft des Mantras, um unsere Yoga-Praktiken zu unterstützen. Er sagt uns, wie wir gesund werden, wie wir ein langes Leben sichern, wie wir unsere sub-humanen Neigungen überwinden und wie wir schließlich die uns innewohnende Göttlichkeit in der Höhle unseres Herzens entdecken können.

„Erkenne deinen Geist und du wirst die ganze Welt erkennen; meistere deinen Geist und du wirst Herr über die ganze Welt werden.“
Die zeitlose Weisheit, welche im Yoga Sutra enthalten ist, führt uns direkt zum Herzen von tausenden großen Meistern der Vergangenheit. Diese Weisheit ist einfach und geradlinig: Kenne deinen Geist und du wirst die ganze Welt kennen; beherrsche deinen Geist und du wirst Herr der ganzen Welt.
Es gibt kein größeres Geheimnis als das des Geistes, und nur ein gesunder, gut kontrollierter Geist kann dieses Geheimnis lüften. Das Yoga Sutra erkennt an, dass der Körper und der Geist gleichermaßen wichtig sind. Ein gesunder Körper ist entscheidend für einen gesunden Geist. Der erste Schritt zur Kultivierung eines gesunden Geistes ist die Kultivierung eines klaren und ruhigen Geistes. Ein solcher Geist befähigt uns zu verstehen, was richtig und was falsch ist, was gesund und was ungesund ist, was gut und was schlecht ist und schließlich, was wünschenswert ist und was vermieden werden sollte.
Unsere Fähigkeit, einen klaren, ruhigen und gelassenen Geist zu erlangen, wird durch unsere Gewohnheitsmuster beeinträchtigt, welche unsere Vorlieben und Interessen bestimmen. Patanjali erkennt zwar an, dass der Geist die Funktionen des Körpers steuert, aber wenn der Geist zum Gefangenen seiner eigenen Gewohnheitsmuster geworden ist, beginnt der Körper, seine eigenen Regeln und Gesetze zu schaffen. In einer solchen Situation öffnet sich ein Riss zwischen Körper und Geist, und wir sind von dem Pool der inneren Intelligenz abgeschnitten, der in uns schlummert – den offenbarenden Kräften des Geistes und den heilenden Kräften des Körpers. Um dieses Problem zu überwinden, bietet Patanjali ein System des inneren Erwachens an – eine Methodik, die uns befähigt, die Weisheit unseres Körpers anzuzapfen, seine schlummernden Kräfte zu erwecken, eine Brücke zwischen Körper und Geist zu schlagen und die innere Göttlichkeit zu erreichen, die im Lotus unseres Herzens wohnt. Das ist das Geschenk des Yoga Sutras.

Einen tiefgehenden Einstieg in die Thematik des Yoga Sutra bietet Dir die Kommentar-Reihe von Pandit Rajmani Tigunait, beginnend mit „Das Geheimnis des Yoga Sutra – Samadhi Pada„.
Dieser Artikel erschien im Original auf HI Online des Himalayan Institute, USA. Deutsche Übersetzung von Michael Nickel und Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Himalayan Institute.
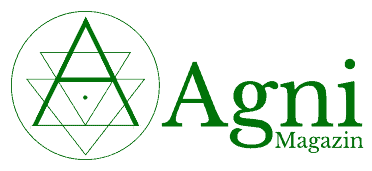
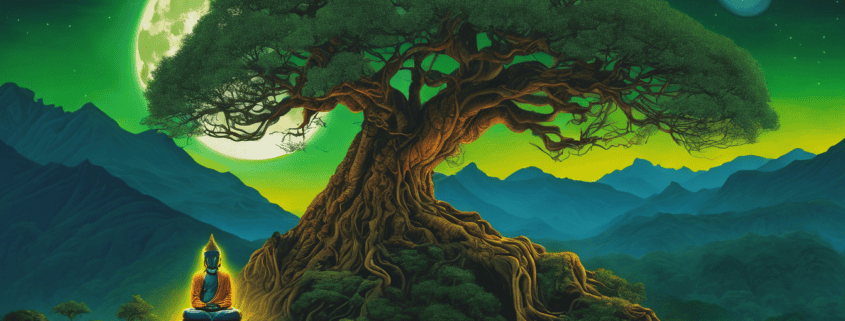
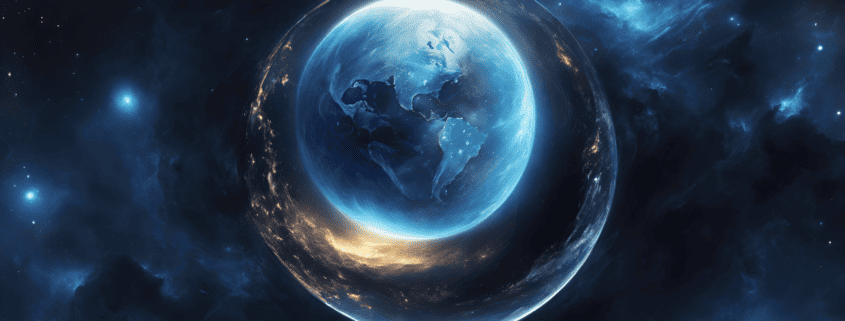
 chelsea-gates / unsplash cc0
chelsea-gates / unsplash cc0






 Jerry Zhank / Unsplash CC0
Jerry Zhank / Unsplash CC0 benjamin-child
benjamin-child

