Lesedauer 5 MinutenAntworten von Pandit Rajmani Tigunait
Frage Agni-Magazin: Wie kann ich am besten Stille üben? Wie lange sollte ich sie üben und wie sollte ich meine Zeit einteilen? Bedeutet „Schweigen“ immer, überhaupt nicht zu sprechen?
Pandit Rajmani Tigunait sagt dazu: Im Yoga wird die Praxis der Stille, der inneren Ruhe, Mauna genannt. Mauna kommt von dem Wort muni – ein Heiliger oder ein Weiser – und bedeutet, die Eigenschaft eines Weisen zu kultivieren oder das zu tun, was uns in eine heilige Person verwandelt. Wenn wir unseren Geist zum Schweigen bringen und unsere Sinne zum Schweigen bringen, führt das automatisch dazu, dass auch unsere lebenswichtigen Organe und unser Nervensystem zum Schweigen gebracht werden. Alles, was wir tun müssen, um unseren Geist und unsere Sinne zum Schweigen zu bringen, nennt man Stille üben. Das ist für jeden von uns anders, denn wir haben alle unsere ganz eigenen Dinge, mit denen wir umgehen und an denen wir arbeiten müssen.
Der erste Schritt ist, so wenig wie möglich zu sprechen. Wenn möglich, sprich überhaupt nicht. Wenn du aber Verpflichtungen hast, dann erledige sie weiterhin, nur eben auf eine zielgerichtete und friedliche Art und Weise, um während dieser Übung einen ruhigen Geist zu kultivieren. Vollständige Stille ist nur im Samadhi möglich. Davor ist es die Praxis der Stille, nicht der Zustand der Stille.

„Vollständige Stille ist nur in Samadhi möglich. Davor ist es die Praxis der Stille, nicht der Zustand der Stille.“
Beginne mit einer kurzen Schweigepraxis: 36 Stunden sind überschaubar, aber wenn du versuchst, zu viel zu tun, ohne vorbereitet zu sein – eine dreitägige, wochenlange oder zehntägige Praxis – und wenn du in dieser Zeit den ganzen Tag nur meditierst, meditierst, meditierst und keine Bücher lesen darfst, kann das zu großer Unruhe führen, und das ist es nicht wert.
Deshalb ist es wichtig, eine Struktur für die Zeit der Stille zu schaffen, die Zeit für Meditation, Kontemplation und Reflexion, für Hatha und Bewegung sowie für das Lesen spiritueller Bücher beinhaltet.
Mach die Meditation zu deinem Ankerpunkt während des Tages. Meditiere alle vier oder fünf Stunden – vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen und dazwischen noch zwei oder drei Mal. Meditation ist die höchste Praxis der Stille. Während du meditierst, denkst du nur an ein einziges Objekt – deinen Prana-Puls, dein Mantra oder was auch immer du als Fokuspunkt wählst. Das bringt deinen Geist zur Ruhe.
Denke einmal morgens und einmal abends für 10 oder 20 Minuten darüber nach, wer du bist. Identifiziere dich mit dem Teil von dir, den du nicht respektierst, mit dem nutzlosen Aspekt von dir. Erkenne vorerst den guten, positiven und konstruktiven Aspekt von dir an (ohne dich damit zu identifizieren) – das, was in dir edel und wertvoll ist. Auf dieser Grundlage kannst du über das Leben und alles, was in dir und außerhalb von dir geschieht, nachdenken. Das wird dir helfen, deinen Geist zum Schweigen zu bringen.

Dann beobachte deine eigene innere Unruhe. Wie ruhelos bist du? Welche Dinge drängen sich auf und verlangen, dass du dich mit ihnen beschäftigst? Diese Gedanken und die Objekte, die mit diesen Gedanken zu tun haben, haben einen sehr wichtigen Platz in deinem Leben eingenommen. Du hast ihnen zu viel Wert beigemessen, und das Schlimmste ist nicht, dass du ihnen zu viel Wert beigemessen hast, sondern dass du ihnen die Macht gegeben hast, dich zu kapern, dich zu entführen. Warum ist das so?
Liegt es daran, dass du nicht viel Geduld hast? Liegt es daran, dass du ängstlich bist? Liegt es daran, dass andere mentale Gewürze hinzugekommen sind, wie Hass oder Rache oder eine sehr starke Abneigung? Was ist es, das deinen Geist so stark in Beschlag nimmt? Achte darauf.
Nimm dir neben deiner Meditation und deinem Nachdenken auch Zeit für deine Hatha-Praxis. Mach auch einen ruhigen Spaziergang, um den Frieden und die Stille der Natur zu genießen.
Dann nimm dein spirituelles Lieblingsbuch zur Hand, z.B. das Yoga Sutra, die Bhagavad Gita oder „Mein Leben mit den Meistern des Himalayas„. Wähle eine Passage aus, die dir wichtig ist, und nutze diese für weitere Kontemplation und Selbstreflexion.
Wenn du deine Stille beendest, versuche, allmählich aus ihr herauszukommen, anstatt direkt in dein normales Leben zu springen. Und achte darauf, was dich als Erstes herauszieht.
So kannst du dein Schweigen üben.
Dieser Artikel erschien im Original auf HI Online des Himalayan Institute, USA. Deutsche Übersetzung von Michael Nickel und Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Himalayan Institute.
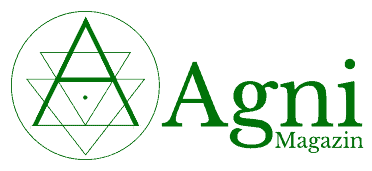










 clarence-e-hsu
clarence-e-hsu michael-walk / unsplash cc0
michael-walk / unsplash cc0